Donnerstagabend im Saal des Gemeinschaftszentrum Jungbusch. Die Mitglieder der Theatergruppe in der Creative Factory kommen wie in jeder Woche zum gemeinsamen Probenabend zusammen. Es geht lebendig zu. Die jungen Frauen, alle im Alter von 18 bis 23 Jahren und mit Migrationshintergrund, kennen sich gut aus Nachbarschaft, aus der Schule und natürlich der Theaterarbeit. Viele sind befreundet miteinander, die meisten wohnen in ihrem „Busch“, sind im ehemaligen Hafenviertel aufgewachsen.
Mit dabei ist auch der 22-jährige Ilies Mimouni, aktiv im Vorstand der Jugendinitiative Jungbusch. „Es ist gut, dass sich der Jungbusch sozusagen ‚resozialisiert‘“, meint Ilies, dessen „Heimland“ Tunesien ist, seine Heimat jedoch Mannheim, wie er betont.
„Wir leiden unter dem Negativimage des Jungbusch“, erklären die jungen BewohnerInnen. „Viele Mannheimerinnen und Mannheimer halten den Jungbusch für asozial“, bemerkt Meltem K., die sich und die im Stadtteil lebenden Menschen mit Migrationshintergrund durch dieses Negativetikett pauschal verurteilt sieht. Dabei habe der Jungbusch viele Vorzüge. Dazu gehören die positiven nachbarschaftlichen Beziehungen, die gute Atmosphäre und menschliche Qualitäten. „Es gibt viel Zusammenhalt“ ergänzt Meltem Y. „Und es wird hier viel gemacht, z.B. Feste, Theater, Nachtwandel, Runtegrate.“
Meltem Y. lebt in der Kirchenstraße, wo sie sich wohlfühlt. Dieser Wohlfühlfaktor ist allerdings nicht in allen Straßen des Stadtteils so, erläutert die junge Frau. „Wenn ich mit meinen Freundinnen durch die Beilstraße oder Böckstraße laufe, begegnen uns abwertende oder anmachende Blicke und Kommentare der Männer. Alleine gehe ich da nur ungern hin.“ Auf die Frage nach der Zukunft gingen die Meinungen auseinander. „Wenn ich mal selbst Kinder habe, kann ich mir das Leben im Jungbusch nur schwer vorstellen“, meint Melek K. „Ich will, dass meine Kinder nicht nur unter Ausländern aufwachsen und in die Schule gehen“, ergänzt ihre Schwester Meltem. Melek Y. hingegen hat sich da noch nicht festgelegt: „Entscheidend ist eine gute und gemischte Bevölkerungszusammensetzung!“, meint sie.
Gefahr der Verdrängung von Familien
Der neuen Entwicklung mit dem Zuzug neuer Bevölkerungsgruppen stehen die jungen Frauen durchaus aufgeschlossen gegenüber. In die Aufbruchsstimmung mischt sich allerdings eine Sorge. „Schlecht wäre es, wenn die Migrantenbevölkerung durch den Zuzug der ‚Neuen‘ an den Rand gedrängt wird“, sagt Melek K., die wie andere aus der Gruppe davon gehört hat, dass einzelne Wohnungen im Jungbusch zu teuer für Familien geworden sind. „Die schönen Wohnungen im Jungbusch muss man sich erstmal leisten können“. Ilies Mimouni wird da schon deutlicher und spricht von steigenden Mieten und der Gefahr der Verdrängung von Familien. Der Stadtteil habe viele Vorzüge, die ihn auszeichneten. Er nennt die Nähe zur Innenstadt, die gute Anbindung an Bus und Bahn oder die Erreichbarkeit von Geschäften. Die Infrastruktur, angefangen vom Arzt bis zu den öffentlichen Einrichtungen, stimme. In der steigenden Attraktivität liege auch die Gefahr: „Ich und viele andere wollen nicht, dass der Jungbusch ein Nobelviertel wird“.
„Der Stadtteil ist uns fremd geworden“
Einige Tage später am gleichen Ort: Fünf junge Männer und eine Frau treffen sich zu einer Probe für das neue Theaterstück Stelline. Kaya ist der erste, der eintrifft. Er wohnt in der Jungbuschstraße. „Wir sind insgesamt acht Geschwister. Einige leben seit 30 Jahren im Jungbusch, haben Kinder, die den Kindergarten oder die Grundschule besuchen“, erzählt der 32-jährige, der den Jungbusch als schwieriges Pflaster beschreibt: „Viele lassen die Kinder aus Sorge nicht mehr alleine auf den Spielplatz“, sagt Kaya und spricht auch von denen, die dem Stadtteil den Rücken kehrten, als sie geheiratet haben. Mustafa, Tuba, Salih und Burak sind inzwischen dazu gekommen. Man spricht über Veränderungen im Stadtteil, die neuen Zuwanderer, über die man immer noch viel zu wenig weiß, das Kneipenleben, das am Wochenende den nächtlichen Schlaf raubt, über dreckige und verwahrloste Hausflure, wo man die ordnende Hand eines Hausmeisters vermisst und über die Nachtschwärmer, die im „Busch“ die Sau rauslassen, weil man sich so nur im Jungbusch verhalten könne.
Hüsseyin bringt es für die Anwesenden auf den Punkt: „Ich habe mich immer wohlgefühlt in meinem Stadtteil. Doch mittlerweile ist mir der Jungbusch fremd geworden“, meint der 27-jährige Student. Auch wir haben uns verändert, ist sich die Gruppe einig. „Wir sind ein Teil dieser Stadt und dieses Landes, wir haben andere Ansichten wie unsere Eltern und auch andere Ansprüche“, meint Hüsseyin. „Und auch ein anderes Selbstbewusstsein“, ergänzt Tuba, die mir noch etwas mit auf den Weg gibt: „Der Jungbusch hat seinen besonderen Flair – und das muss so bleiben!“
MS
























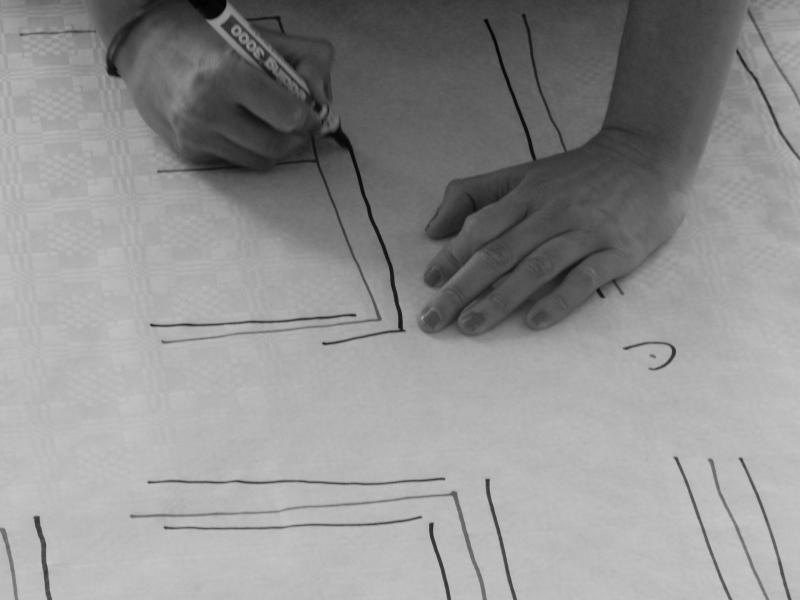


























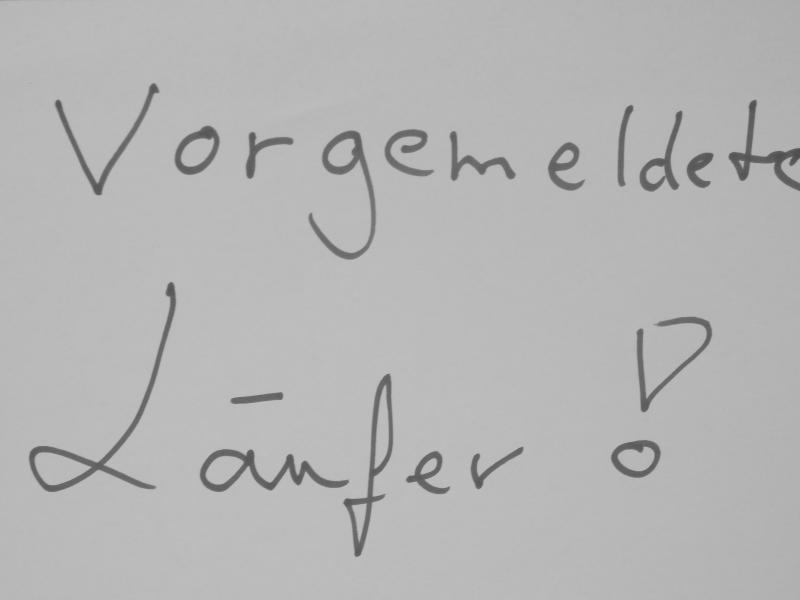

































































































































































 Der Computer Doktor in Mannheim
Der Computer Doktor in Mannheim