
Der Jungbusch im Spiegel ethnologischer Forschung / Interview mit Esther Baumgärtner / „Es braucht eine dauerhafte Plattform …“
Viele Ethnologen reisen in weit entfernte Länder, um fremde Kulturen zu erforschen. Esther Baumgärtner dagegen blieb im eigenen Land und machte den Jungbusch zu ihrem Forschungsgegenstand. In einem Interview offenbart sie die wichtigsten Erkenntnisse ihrer Forschung und spricht Empfehlungen für den Jungbusch von heute und morgen aus.
BT: Frau Baumgärtner, Sie haben als Ethnologin über den Jungbusch geforscht. Was war Ihr Thema?
EB: Als ich vor 10 Jahren zum ersten Mal in den Jungbusch kam, existierten sehr viele Vorurteile über das Quartier. Mich interessierte, wie die Bewohner mit den Fremdbildern über den Jungbusch umgehen. Wie denken sie darüber, dass die Leute sagen, da gehen wir nicht hin, da ist es gefährlich oder asozial? Und ich habe mich gefragt, wie es ist, da zu wohnen. Ich wollte die Sichtweisen der verschiedenen Bewohnergruppen erkunden.
BT: Wie sind Sie als Forscherin vorgegangen?
EB: Ich habe mir hier eine Wohnung gesucht. Vor Ort zu sein, gehört in der Ethnologie dazu. Das hat sich auch als wichtig für meine Gesprächspartner herausgestellt. Die Leute haben es satt, dass jemand kommt, der hier nicht lebt, aber ihnen sagt, wie das multikulturelle Zusammenleben zu laufen hat. Diese Leute leben in einem Stadtteil, über den Andere nur theoretisieren oder den sie nur vom Hörensagen kennen. Außerdem bin ich zu Veranstaltungen des Quartiermanagements gegangen. Dort habe ich viele Menschen getroffen, die ich befragen konnte. Zudem habe ich mit der Geschichtswerkstatt zusammen gearbeitet und Stadtteilspaziergänge mit Bewohnern gemacht. Parallel habe ich im Stadtarchiv die Artikelsammlungen über den Jungbusch untersucht.
BT: Was waren die wichtigsten Ergebnisse?
EB: Was mich am meisten verwundert hat, war, wie stark die Zukunftsplanung für die eigene Familie davon beeinflusst wird, ob eine Person im Jungbusch bleiben oder nicht bleiben möchte. Es gab Leute, die gesagt haben, ich finde es toll hier, bin super gerne im Jungbusch, das ist mein Zuhause. Aber wenn ich ein Kind hätte, würde ich wegziehen. Man wisse ja, wie die Kindheit hier ist, wie die Karrieren verlaufen. Von der Grundschule in die Hauptschule, in die Arbeitslosigkeit. Die Leute wollen ihrem Kind etwas anderes bieten, ein weniger problematisches und stigmatisiertes Umfeld, eine unbeschwerte Kindheit. Oft wird der Jungbusch auch mit einer Lebensphase assoziiert. Studenten sagen, hier zu wohnen sei cool und hat so was von Filmkulisse. Migranten mit geringen Kenntnissen der deutschen Sprache heben hervor, hier sei ein Stück Heimat in der Fremde. Und Jugendliche sagen, hier darf man Türke, Italiener oder Deutscher sein, jeder kann hier hergehören, der hergehören will.
BT: Was macht die Identität der Jungbuschbewohner aus?
EB: Sehr spannend finde ich diese Vermischung globaler Stile mit lokalen Elementen und der Herkunftskultur von Migranten. Was dabei herauskommt, passt gut zusammen. Das sieht man z.B. bei den Aufführungen der „creative factory“, wenn das Türkische ebenso wie das Kurpfälzische und andere Sprachelemente in die Texte einfließen.
BT: Was wäre, wenn der Jungbusch von heute auf morgen populär wäre – ein tolles Viertel, sozial sehr angesehen?
EB: Das würde heißen, dass man es tatsächlich in Deutschland schafft, sozial schwächere und kulturell andersartige Gruppen als Teil dieses Landes zu betrachten und nicht als Jemanden, dem man unsere „Leitkultur“ beibringen muss. Es wäre insgesamt sehr positiv, denn viele Menschen im Jungbusch, die sich sozial und kulturell betätigen, haben es verdient, eine Anerkennung zu bekommen für das, was sie hier tun.
BT: Welchen Beitrag können die Erkenntnisse leisten, um das Zusammenleben im Jungbusch zu unterstützen?
EB: Vieles geht in eine richtige Richtung, doch es braucht noch mehr Engagement. Noch mehr Bewohner sollten sich als Experten für ihren Stadtteil und ihre Kultur begreifen und damit in einen Austausch mit anderen Bewohnern treten. Es gibt vor Ort sehr unterschiedliche Lebensstile, die eine Person erleben kann, wenn sie auf Andere zugeht.
BT: Welche konkreten Empfehlungen haben Sie an die Stadt Mannheim?
EB: Die Stadt hat sich über einen gewissen Zeitraum intensiv mit dem Jungbusch befasst. Das war sehr wichtig. Jetzt habe ich den Eindruck, dass der Jungbusch in den Hintergrund rückt. Man sollte nach der Nachhaltigkeit schauen. Man kann nicht einfach nur irgendwas bauen. Man muss auch sehen, wer das nutzt, und ob es den Zweck erfüllt, den es erfüllen soll. Außerdem ist es nachteilig, dass viele soziale Projekte oftmals auf einen kurzen Zeitrahmen ausgelegt sind. Gerade die langfristigen Beziehungen in sozialen Einrichtungen sind den Akteuren im Jungbusch von großer Wichtigkeit. Die Leute brauchen ein kontinuierliches Angebot. Die Verortung im Jungbusch ist massiv abhängig von den Netzwerken, welche die Menschen hier knüpfen. Es braucht eine dauerhafte Plattform, um sich kennenzulernen.
BT: Jungbusch 2020, was ist anders als heute?
EB: Der Jungbusch ist dann einerseits reicher, weil sich in 10 Jahren viel tun wird und die Perspektiven für Jugendliche hoffentlich anders und weniger davon geprägt sind, dass sie im Jungbusch aufgewachsen oder sozial schwach sind. Aber der Jungbusch wird auch etwas verlieren, denn gerade die alteingesessene Bevölkerung hat einen unglaublichen Schatz an Erinnerungen, die einen Jungbusch wach halten, wie wir ihn gar nicht mehr kennen.
Das Interview mit Esther Baumgärtner (EB) führte Bettina Franzke (BT) für die Buschtrommel.
Literatur: Esther Baumgärtner: „Lokalität und kulturelle Heterogenität. Selbstverortung und Identität in der multi-ethnischen Stadt“.























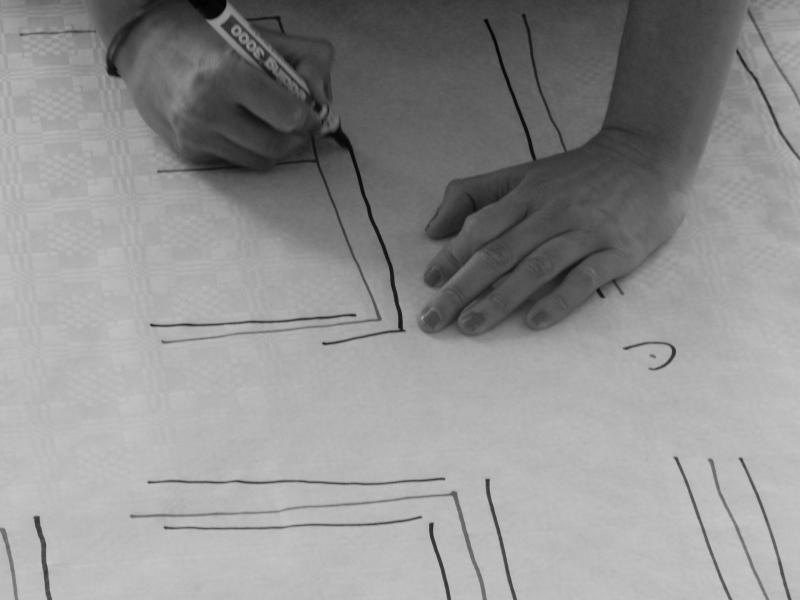


























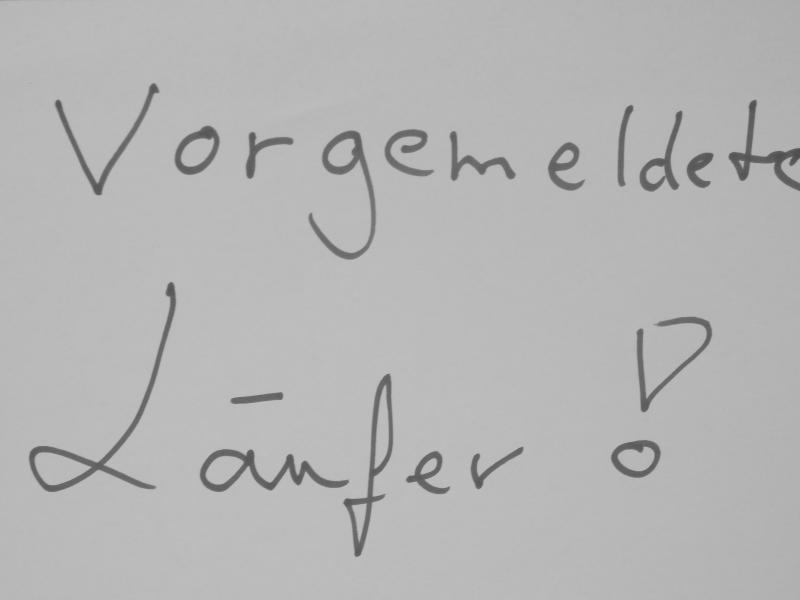

































































































































































 Der Computer Doktor in Mannheim
Der Computer Doktor in Mannheim