Der Mord an Gabriele Z. hat Menschen in Mannheim und im Jungbusch erschüttert. Zum einen wurde viel Verbundenheit mit der Jungbuschbewohnerin sichtbar. Zum anderen musste der Stadtteil wieder einmal erfahren, wie schnell ihn negative Zuschreibungen als „gefährlicher“ Stadtteil ereilen. Der Realität entspricht das nicht. Laut Kriminalstatistik ist es im „Busch“ nicht gefährlicher als anderswo. Die Redaktion hat deshalb den Soziologen Dr. Lukas gebeten, einen Beitrag zum Thema Angst-räume zu verfassen. Anschließend zeigen Bewohner des Stadtteils ihre persönliche Sicht auf den Jungbusch und machen deutlich, was einen „sicheren“ Stadtteil ausmacht.
Entsetzliche Ereignisse wie der Sexualmord an der Studentin Gabriele Z. lenken die Aufmerksamkeit auf Fragen der Sicherheit im öffentlichen Raum. Besonders Frauen bekunden nach derartig grausamen Vorfällen, Angst zu haben und sich auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen nicht sicher zu fühlen. Kriminalitätsfurcht beschreibt allgemein die Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden. Kriminologische Untersuchungen weisen regelmäßig darauf hin, dass Frauen eher dazu neigen, sich vor Straftaten zu fürchten als Männer und dass die Angst häufig sehr viel größer ist, als es die Raten der registrierten Kriminalität erwarten lassen. Oftmals lässt sich die gefühlte Sicherheit anhand der rein objektiven Kriminalitätslage kaum nachvollziehen. Im gesellschaftlichen Verständnis gilt der öffentliche Raum üblicherweise als unsicher und gefährlich, während der private Raum Sicherheit und Geborgenheit verspricht. Frauen aber sind von häuslicher Gewalt mehr bedroht als durch andere Gewaltdelikte im öffentlichen Raum. Der Umgang mit (Ex-) Partnern, Verwandten und Freunden kann für Frauen sehr viel gefährlicher sein als der Kontakt zu Fremden. Statistisch ist der öffentliche Raum für Frauen vergleichsweise sicher, Bedrohungen und Gefahren lauern vielmehr in den eigenen vier Wänden: Etwa zwei Drittel aller Gewalttaten gegen Frauen entfallen auf den sozialen Nahbereich, d.h. die Wohnung. Dass der öffentliche Raum kriminalitätsbezogene Unsicherheitsgefühle befördert, hat weniger mit dessen tatsächlicher Kriminalitätsbelastung als mit der Wahrnehmung bestimmter Phänomene zu tun, die als sichtbare Zeichen der Bedrohung den Verfall gemeinsam geteilter Werte und Normen zu signalisieren scheinen. Es sind dies zumeist unbedenkliche, aber unangenehme Ereignisse unterhalb der Schwelle zur Strafbarkeit, die Unsicherheit im öffentlichen Raum hervorrufen. Dazu zählen abweichende Handlungen wie der öffentliche Alkoholkonsum oder das Herumhängen Jugendlicher genauso wie Graffiti, Müll und Hundekot oder Erscheinungsformen der Verwahrlosung wie verfallene Gebäude oder zerstörte Haltestellen von Bus und Straßenbahn. Zeichen der sozialen Unordnung zeigen an, dass sich niemand für diesen Ort verantwortlich fühlt. An solchen Orten ist das subjektive Sicherheitsgefühl in aller Regel nur gering ausgeprägt.
Angsträume vermeiden
Angst und Unsicherheit sind im städtischen Raum höchst unterschiedlich verteilt. Polizeilich erfasste Gewalttäter haben ihren Wohnort oft in bestimmten Stadtteilen. Ebenso gelten manche Orte als regelrechte „Angsträume“, in denen das Gefühl der Bedrohung durch Kriminalität besonders stark ausgeprägt ist. Angsträume sind Orte, die aufgrund ihrer Baustruktur und Lage von der Bevölkerung gefürchtet und, wenn möglich, gemieden werden. Typischerweise handelt es sich dabei um Orte, deren räumliche Gestalt Orientierungs- und Wahlmöglichkeiten bei der Durchquerung einschränkt und die Ausübung sozialer Kontrolle erschwert. Dunkle Unterführungen oder unübersichtliche Grünanlagen sind gängige Beispiele für öffentliche Räume, die das Sicherheitsgefühl vieler Menschen beeinträchtigen. Auch Gabriele Z. wurde tot an einer „dunklen, finsteren Ecke“ (rndelta.de) aufgefunden, die aufgrund ihrer städtebaulichen Anlage unterhalb des mehrspurigen Auffahrtkreuzes der Kurt-Schumacher-Brücke nur schwer zu überblicken und durch lauten Straßenlärm gekennzeichnet ist.
Strategien zur Vermeidung von Angsträumen zielen regelmäßig auf die baulich-architektonische Umgestaltung solcher angstbesetzter öffentlichen Räume. Statt hoher Sträucher und Hecken sollen niedrige Büsche und Baumbepflanzungen Blickbeziehungen und gute Orientierungsmöglichkeiten begünstigen. Übersichtlich soll es sein, gut beleuchtet und sozial kontrollierbar. Auch die Videoüberwachung des öffentlichen Raumes, wie sie derzeit von Seiten der Mannheimer Polizei nur noch auf dem Willy- Brandt-Platz betrieben wird, soll in diesem Rahmen einen Beitrag zu einem Mehr tatsächlicher wie gefühlter Sicherheit leisten. Die Wirksamkeit der Videoüberwachung ist jedoch nicht eindeutig nachgewiesen. Zum einen führt die Überwachung einzelner Orte zur Verdrängung der Kriminalität an andere, nicht-überwachte Orte. Zum anderen können auch die Effekte auf das Sicherheitsempfinden negativ sein. Kameras im öffentlichen Raum erzeugen ein mitunter mulmiges Gefühl: Dieser Ort muss gefährlich sein, warum sonst sollte er videoüberwacht werden? In der Folge werden solche Orte von der Öffentlichkeit eher gemieden, was zur weiteren Verschlechterung der Situation an diesem Ort führen kann.
Sozialen Zusammenhalt stärken
Sinnvoller erscheint daher neben der städtebaulichen Gestaltung des öffentlichen Raumes die infrastrukturelle Arbeit mit den Nutzern dieses Raumes. Mit Spielplätzen, Parks, Geschäften und Nachbarschaftszentren kann eine Infrastruktur geschaffen werden, die für den Aufbau sozialer Kontakte förderlich ist. Soziale Beziehungen sind das Rückgrat urbaner Sicherheit. Städtische Räume, in denen die Bevölkerung gemeinsam Verantwortung übernimmt, sind nicht nur sicherer im Sinne einer geringeren Belastung mit Kriminalität, sie sind zugleich auch mit weniger Unsicherheitsgefühlen verbunden. Entscheidend dafür sind der soziale Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen unter den Mitgliedern der Gemeinschaft, die die Ausübung kollektiven Kontrollhandelns im öffentlichen Raum überhaupt erst ermöglichen. Kriminelle Ereignisse, so abscheulich sie sind, bedeuten in diesem Zusammenhang nicht, immer mehr Sicherheitsmaßnahmen zu fordern oder zu ergreifen, sondern sich von unüberlegten Aktionen unabhängig zu machen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Auf diese Weise entstehen lebendige Strukturen, die eine Stadt lebenswert machen.
Dr. Tim Lukas ist Soziologe und Leiter der Abteilung Objektsicherheit am Institut für Sicherungssysteme der Bergischen Universität Wuppertal. Er beschäftigt sich vor allem mit Fragen der Sicherheit in der Stadt und den Möglichkeiten der städtebaulichen Kriminalprävention. Im Rahmen eines Forschungsprojektes war er mehrere Monate als teilnehmender Beobachter
Hier sind immer Menschen auf der Straße
Seit dem furchtbaren Tod Gabriele Z.‘s im Hanielpark ist eine Debatte um die Sicherheit in Mannheim und besonders im Jungbusch entbrannt. Journalisten schreiben „Das Herumhängen Jugendlicher genauso wie Graffiti, Müll und Hundekot“ stellten soziale Unordnung dar und förderten das Gefühl der Unsicherheit. Ich bin weiblich, Bewohnerin des Jungbuschs und mag keinen Müll auf den Straßen. Genauso trete ich nur ungern in Hundekot. Aber Jugendliche auf der Straße und Graffitis sind für mich belebende und positive Faktoren des Jungbuschs. Laufe ich schwer bepackt durch die Beilstraße, wird mich immer ein Jugendlicher fragen, ob ich Hilfe brauche. Meine Nachbarn kenne ich alle mit Namen und so auch die Jugendlichen, die sich in der Beilstraße aufhalten. Sie sind sehr nett, fragen immer nach dem Wohlbefinden und geben mir das Gefühl von Sicherheit.
Der Mord im Hanielpark ist eine Katastrophe. Und es ist wahr, wenn geäußert wird, dass besonders an dem Tatort das Gefühl von Unsicherheit entsteht, da er sehr unübersichtlich und duster ist. Ich fühle mich aber in den Straßen des Jungbusches noch immer so sicher wie bisher. Denn hier sind immer Menschen auf der Straße – Menschen, die mir nie etwas tun würden. Im Gegenteil: für mich einstehen würden, wenn etwas passieren würde. Wer sich von den Menschen hier bedroht fühlt, der hat sie nicht kennengelernt.
Nina Aleric, Bewohnerin
Brauchen wir sicherere Zugänge zum Jungbusch?
Gabriele Z. wurde im diesen Herbst tot im sogenannten Hanielpark aufgefunden. Sie befand sich auf dem gleichen Heimweg, den ich, sowie viele andere Studenten und Bewohner des Jungbuschs, hunderte Male beschritten haben. Ihr Tod hat viele Menschen betroffen aber auch ängstlich gemacht. Bin ich noch sicher auf meinen Wegen? Vor allem, wenn dieser Weg der gleiche ist, an dem diese Tat begangen wurde?
Heute habe ich mir besagte Stelle genau angeschaut. Es war circa 18 Uhr und es stimmt: Sie ist dunkel, uneinsichtig, beklemmend. Doch viele Alternativen zu diesem Weg in den Jungbusch gibt es nicht. Auch die Straßenbahnhaltestelle ist dort und durch seine Lage zwischen Hafen und Neckar sind die Zugänge zum Stadtteil begrenzt. Muss hier etwas getan werden?
Was gäbe es für Möglichkeiten? Man könnte dafür plädieren, andere Zugänge zum Jungbusch zu schaffen, um die vermeintliche Unsicherheit im Hanielpark meiden zu können. Eine andere Möglichkeit wäre, den Ort an sich zu verändern, zu „verbessern“. Beide Vorschläge eröffnen zuallererst die Frage nach der Machbarkeit. Die Öffnung dieses Raumes oder neuer Räume wäre mit großen Umbaumaßnahmen verbunden. Doch die größere Frage ist für mich, was passiert, wenn wir anfangen, diesen Raum zu meiden? Empfinden wir ihn dann nicht erst recht als gefährlich? Und was passiert, wenn wir ihn verändern? Wenn wir Hecken schneiden, Bilder malen und Blumen pflanzen? Was passiert durch diesen Artikel?
Ich bin dafür, dass wir den Menschen, einen sicheren Zugang zu einem für viele sehr wichtig gewordenen Stadtteil ermöglichen. Ich bin dafür, dass sich jemand für diese Zugänge verantwortlich fühlt. Dass ihnen Zuneigung gegeben wird, genauso, wie den Orten im Jungbusch, zu denen sie führen. Aber es sollte uns nicht dazu verleiten, dass diese Mühen auf Kosten von langfristigen Bestrebungen gegen Gewalt in unserer Gesellschaft gehen: Das Schaffen von guten sozialen Strukturen, Aufklärung, Integration und Enttabuisierung. Max Frisch schrieb: „Kassandra, […] die scheinbar Warnende […], ist sie immer ganz unschuldig an dem Unheil, das sie vorausklagt?“. Vorsicht ist daher geboten, nicht bei der Besprechung des Mordes und seiner Konsequenzen, zu einem Feindbild beizusteuern; Menschen und Orte auszugrenzen. Für mich ist das Wichtigste am Jungbusch, dass er ein Ort ist, an dem Menschen, die sich anderswo am Rande der Gesellschaft befinden, Seite an Seite mit denen leben, die die Fäden unserer Gesellschaft in den Händen halten. Wenn wir möchten, können wir Blumen pflanzen, aber wir sollten keine Angst schüren, die diesem Miteinander schaden könnte.
Kristina Meier
























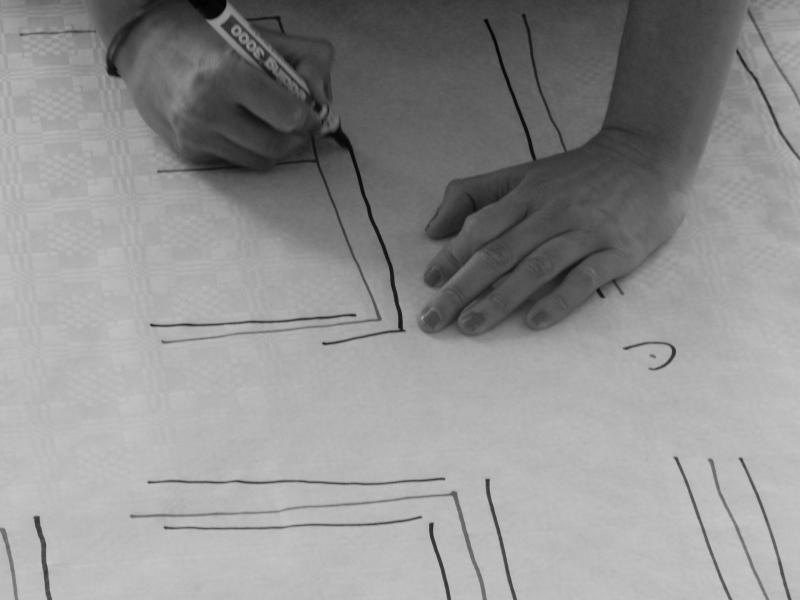


























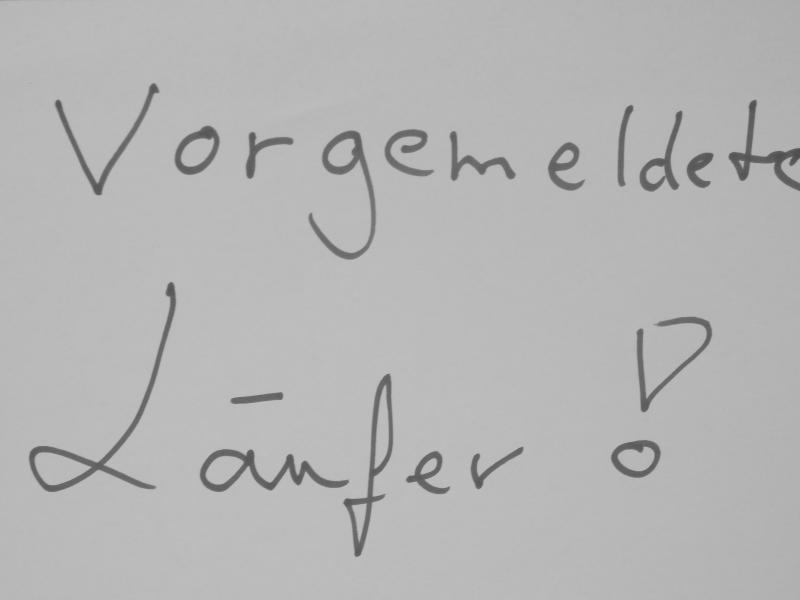

































































































































































 Der Computer Doktor in Mannheim
Der Computer Doktor in Mannheim